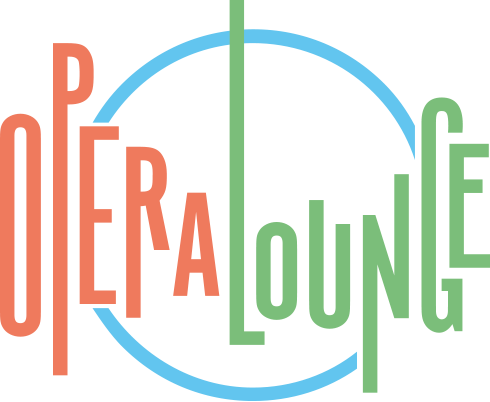Sergei Prokofjews Kantate zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution. Hundert Jahre Oktoberrevolution. Fast dreißig Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion muss das große Spektakel ausbleiben. Anders sah dies freilich zu Zeiten Stalins aus, der das Sowjetimperium zwischen Ende der 1920er Jahre und 1953 beherrschte – oder vielmehr terrorisierte. Zum 1937 anstehenden 20. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution (wie sie seinerzeit offiziell genannt wurde) komponierte niemand Geringerer als Sergei Prokofjew, zweifelsohne alles andere als ein Stalinist, eine Kantate für Sprecher, zwei vierstimmige gemischte Chöre, Akkordeon-, Blechbläser- und Schlagzeug-Ensemble und Orchester mit insgesamt zehn Sätzen. Ganze zwei Jahre dauerte die Arbeit an dem propagandistischen Werk, das dann freilich zum Jubiläumstag gar nicht zur Aufführung gelangte – Prokofjew war in Ungnade gefallen (offiziell wurde das Spektakel wegen „linksradikaler Abweichung und Vulgarität“ abgesagt). Ein riesiges Konzert auf dem Roten Platz in Moskau mit 500 Musikern und Sängern hätte die Feierlichkeiten am 7. November (julianisch 25. Oktober) 1937 krönen sollen. Für die Textauswahl war der seinerzeit in Paris lebende Philosoph und Musikwissenschaftler Pjotr Swutschinski zuständig. Freilich hätte man durchaus sarkastische Töne heraushören können, die Prokofjew auf dem Höhepunkt des Großen Terrors zum Verhängnis werden hätten können. Tatsächlich sollte es noch beinahe drei Jahrzehnte dauern, ehe die Kantate doch noch erklang, lange nach dem am gleichen Tag erfolgten Tode Stalins und des Komponisten. 1966 brachte sie der berühmte sowjetische Dirigent Kirill Kondraschin zur Uraufführung, allerdings in bearbeiteter Form (eine Einspielung erfolgte im Jahr darauf). Die beiden Sätze mit Stalin-Bezug (Nr. 8 und 10) wurden gestrichen, dafür am Ende der zweite Satz wiederholt. Stehen blieben die Texte von Marx, Engels und Lenin. In seiner Urfassung konnte man das Werk erst 1992, ironischerweise kurz nach dem Ende der UdSSR, in London unter Neeme Järvi hören.
Nun also, zum 100. Jubiläum, besorgt mit dem Ukrainer Kirill Karabits ein weiterer renommierter Dirigent der jüngeren Generation eine Neueinspielung dieses zumindest problematischen Werkes im Zuge des Kunstfestes Weimar (Audite 97.754). Ihm zur Seite stehen der Ernst Senff Chor Berlin, die Staatskapelle Weimar und Mitglieder des Luftwaffenmusikkorps Erfurt. Es wurde also gewissermaßen alles in Gang gesetzt, um diesem wenig bekannten Werk eine neue Chance zu verschaffen und seinem künstlerischen Wert auf den Grund zu gehen. Vom Sturm auf das Winterpalais des Zaren über Lenins Tod bis hin zur Verabschiedung einer neuen Verfassung durch Stalin zieht sich das episch angelegte Opus. Dass es sich um eine Live-Aufnahme handelt, kann man gelegentlichen Publikumsgeräuschen entnehmen. Ansonsten ist der Klang ausgezeichnet eingefangen worden. Inwieweit der deutsche Chor den russischen Texten gerecht wird, müsste indes ein Muttersprachler beurteilen. Hervorgehoben werden sollte, dass die gerade erst im August erfolgte Aufführung bereits jetzt, im November, pünktlich zum 100. Jubiläum, auf CD erscheint.
Vergleicht man die Neuaufnahme mit der 50 Jahre alten unter Kondraschin (Melodija), fallen in den vergleichbaren Sätzen (damals entfielen ja derer zwei) die sehr ähnlichen, teilweise bis auf die Sekunde identischen Spielzeiten auf. Hat sich Karabits an Kondraschin orientiert? In einigen wenigen Abschnitten lässt dieser sich ein klein wenig mehr Zeit, so in der Zwischenmusik des dritten Satzes und beim Sieg der Revolution im siebten Satz. Dies allein ist freilich kein Qualitätsmerkmal. Dass die Moskauer Philharmoniker und der Staatliche Jurlow-Chor zu Breschnews Zeiten noch idiomatischer agieren als die gleichwohl sehr engagierten deutschen Kräfte, liegt auf der Hand. Besonders während des Revolutionssatzes (Nr. 6) geht Karabits gleichwohl aufs Ganze. Die ihm innewohnende Brutalität wird durch schrille Glocken und Sirenen und mörderische Maschinengewehrschüsse unterstrichen. Als Krönung des Ganzen dann noch ein Sprecher mit Megaphon, der die Stimme Lenins verkörpert. Karabits ließ es sich nicht nehmen, dies selbst zu übernehmen. Der dramatische Höhepunkt des Werkes darf hier verortet werden. Nach dem triumphalen Sieg sodann pathetisch verklärend der im achten Satz erfolgende Eid. Die an vorletzter Stelle placierte, rein instrumentale, etwa sechsminütige sogenannte Sinfonie könnte aus einer derselben des Komponisten stammen. Zuletzt die von Stalin auf den Weg gebrachte Verfassung, die diesen Namen kaum verdiente und in der alten Sowjetaufnahme auch gestrichen wurde. Naturgemäß erreicht das Pathos im Finale seinen Höhepunkt. Schwere Kost, die man sich allenfalls anlässlich allfälliger Jubiläen antun sollte. [...]