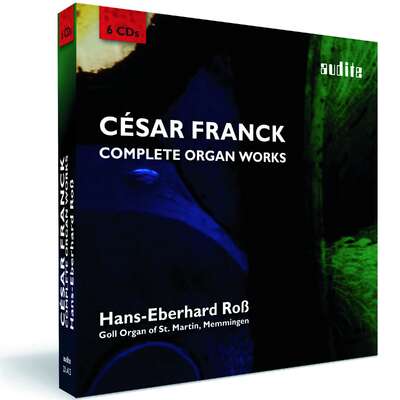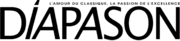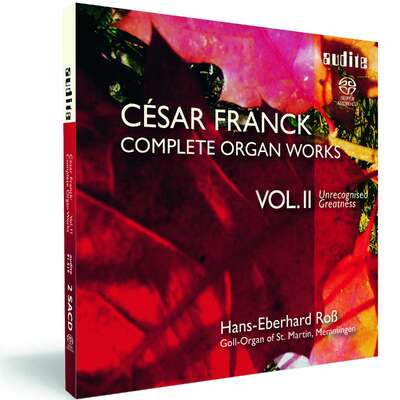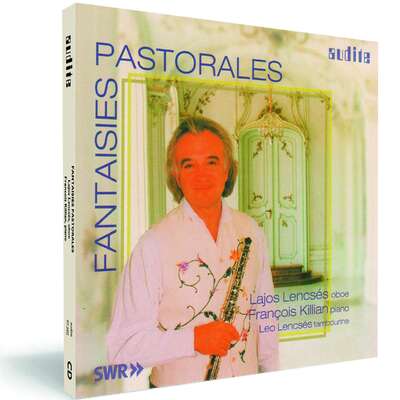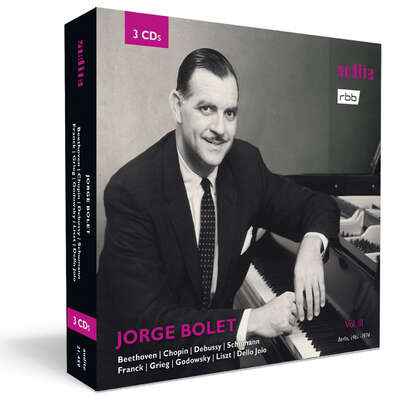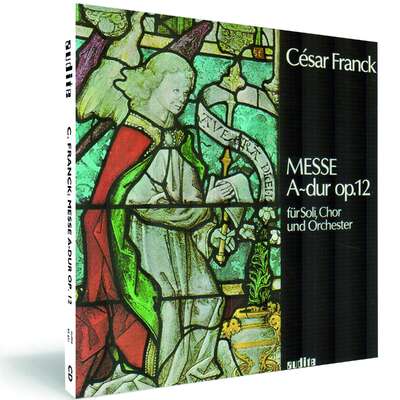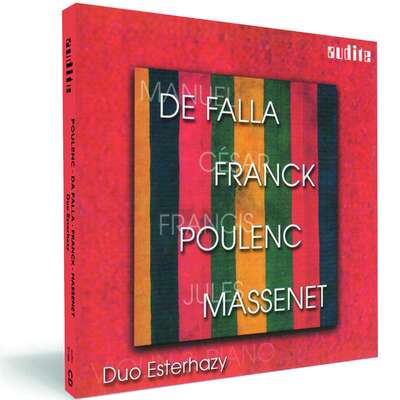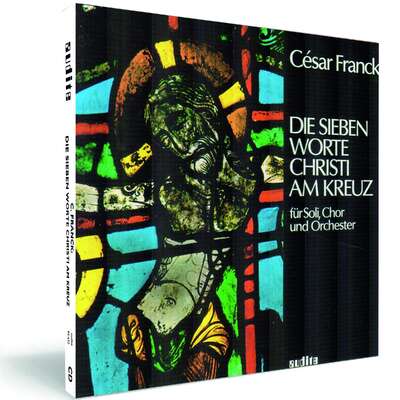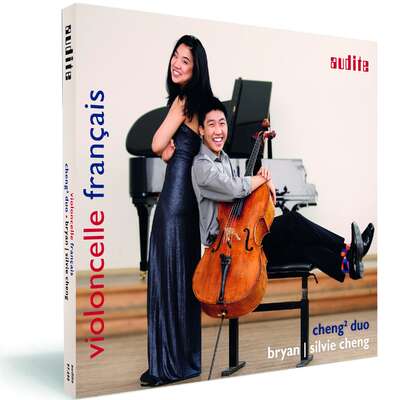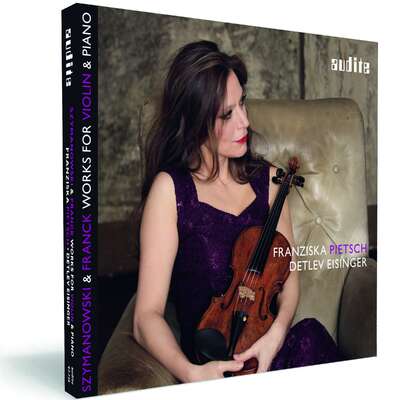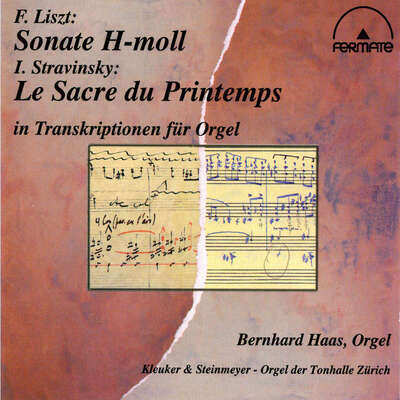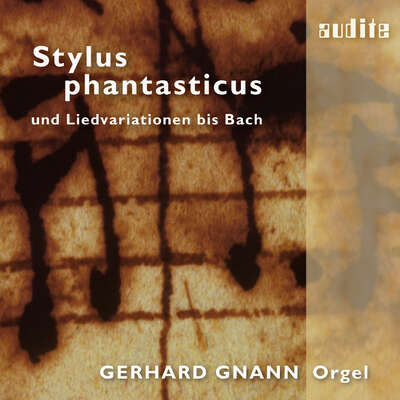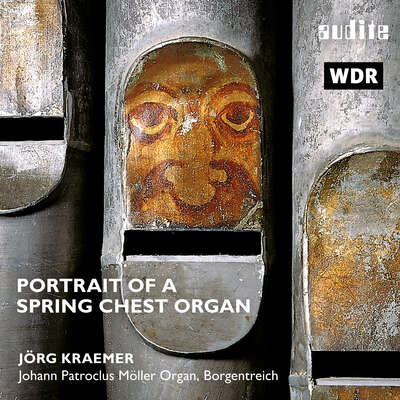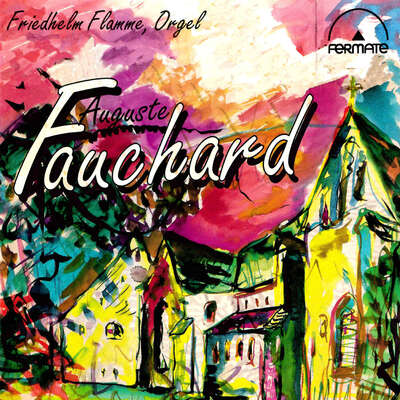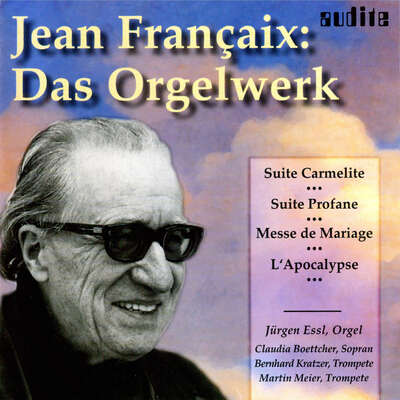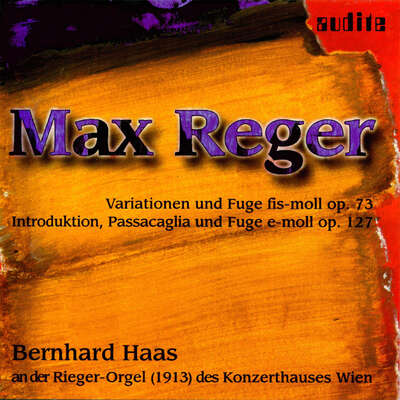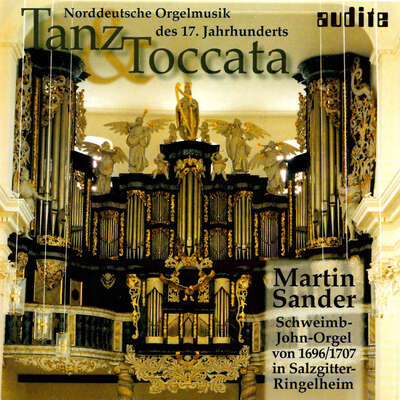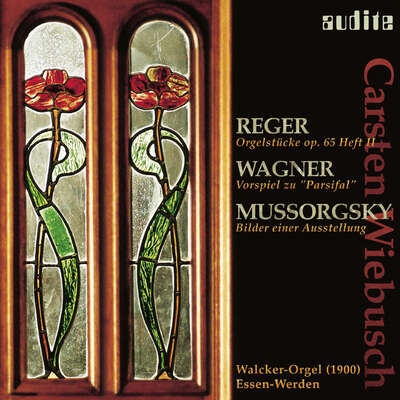Fono Forum | 6/2006 | Christoph Vratz | June 1, 2006
Sechs statt zwei
In drei Folgen – „Vom Wunderkind zum Komponisten“, „Verkannte Größe“, „Erfüllung und Abschied“ – wird uns, so verkündet es derMehr lesen
In drei Folgen – „Vom Wunderkind zum Komponisten“, „Verkannte Größe“, „Erfüllung und Abschied“ – wird uns, so verkündet es der Text auf der CD-Hülle, das komplette Orgelwerk von César Franck vorgestellt – erstmalig. Nun zählt Franck unter Organisten nicht gerade zu den chronisch Vernachlässigten; also muss es eine Erklärung geben, warum seine Orgelwerke nun sechs statt der üblichen zwei bzw. drei CDs füllen.
Hans-Eberhard Roß hat an der Goll-Orgel in Memmingen neben den Standardwerken auch jene teilweise posthum erschienenen Kompositionen eingespielt, die Franck für Orgel oder Harmonium geschrieben hat. Nichts Ungewöhnliches, da in Frankreich die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen beiden Instrumenten weit enger ausgelegt wurden als etwa zur gleichen Zeit in Deutschland. So hat beispielsweise Louis Vierne Francks fünf Stücke von 1856 für Orgel transkribiert, ohne dafür grundlegend in den Notentext eingreifen zu müssen. Im Falle der „Pièces posthumes“, 1905 von Francks Sohn Georges herausgegeben, ist zwar die Wahl des Instruments freigestellt, doch es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Franck die Orgel favorisiert habe. Die umfangreichste Sammlung für Orgel oder Harmonium, „L'Organiste I“, blieb unvollendet. Von den ursprünglich 100 Sätzen sind lediglich 63 überliefert. Nach Aussage von Francks Schüler d'Indy handelt es sich hierbei um Magnificat-Versetten, kleine liturgische Häppchen für den Vespergottesdienst – eine Behauptung, die in ihrer Absolutheit nicht ganz richtig sein dürfte.
Roß spielt diese, zwischen wenigen Sekunden und maximal fünf Minuten langen Stückchen mit penibler Dynamisierung und umsichtiger Registrierung. Jedes dieser Werke erhält dadurch einen eigenen Charakter. Roß nutzt sein feines Legato-Spiel, um aus einzelnen Tönen ein Gewebe aus Klängen zu bilden, die einander ergänzen und sich wechselseitig etwas mitzuteilen haben. Durch den Miniaturcharakter dieser Werke gewinnt der Hörer den Eindruck, als führe Roß eine Kamera: Auf ein zartes Andantino folgt unvermittelt ein plüschiges Maestoso, auf ein „Poco Allegro“ ein kurzes „Amen“ und ein gemächliches „Offertoire“. Dadurch fügen sich diese Einzelwerke zu kleinen Suiten.
Bei Francks großen Orgelwerken, den Chorälen, dem „Final“ oder der „Grande Pièce Symphonique“, fällt auf, dass Roß zügig unterwegs ist. Egal, ob man Olivier Latry (DG), Eric Lebrun (Naxos), Daniel Roth (Motette) oder Jean Guillou (Dorian) zum Vergleich heranzieht, stets wählt Roß die rascheren Tempi. Nun ließe sich dieser Befund damit begründen, dass die genannten Einspielungen allesamt an Cavaillé-Coll-Orgeln bzw. diesen nachempfundenen Instrumenten entstanden sind und dadurch per se andere Klangvoraussetzungen bieten. Im Booklet weist Martin Weyer auf das Problem der Wahl zwischen historischer Nähe und modernem Orgelbau hin: „Unter dem Deckmantel historischer Exaktheit hat sich ein neuer musikalischer Materialismus eingeschlichen, der den Interpreten zum Vollzugsbeamten des Instrumentenkundlers macht und seine Eigenverantwortung reduziert.“ Gern hätte man an dieser Stelle auch ein Wort des Künstlers gelesen und seine Einschätzung über das eher unbekannte Franck-Repertoire kennen gelernt.
Roß missbraucht seine Tempi nicht für virtuose Zwecke, ihm geht es nicht um ein Kräftemessen. Vielmehr vermeidet er so Schwere und Weihe. Sein Spiel ist nie altherrenhaft, sondern birgt einen gewissen „elan vital“. Etwa, wenn er in der „Grande Piece Symphonique“ die Triolenketten der rechten Hand unbeirrt rasch abspult und die Aufmerksamkeit dadurch ganz auf das Thema im Pedal lenkt. Der folgende Übergang zu den langen Halben wirkt wie der Eintritt in eine andere Welt – doch auch diese ist nur eine Zwischenstation vor dem nachstehenden Andante. Roß spielt seinen Franck auf durchdachte, überzeugende, nie philosophisch überladene Weise.
Das Klangbild ist als großes Plus zu werten. Die Orgel wird weder künstlich an unser Ohr herangezoomt noch verliert sich ihr Klang breiig im weiten Raum des Kirchenschiffes. Sie klingt natürlich und klar; den Hörer erwartet eine angenehme räumliche Mischung aus Distanz und Nähe.
In drei Folgen – „Vom Wunderkind zum Komponisten“, „Verkannte Größe“, „Erfüllung und Abschied“ – wird uns, so verkündet es der