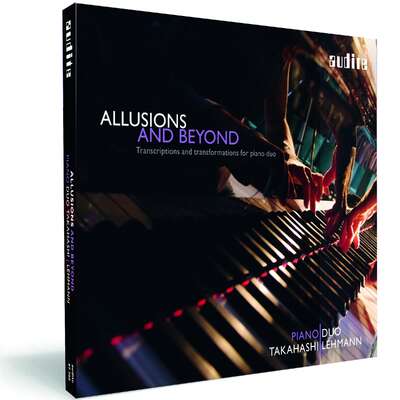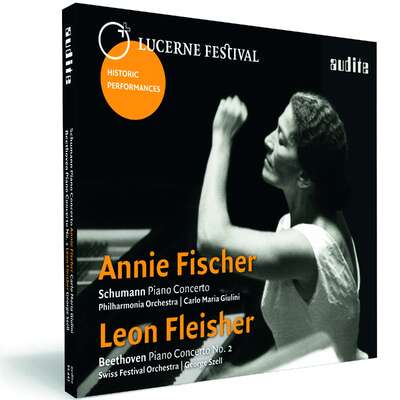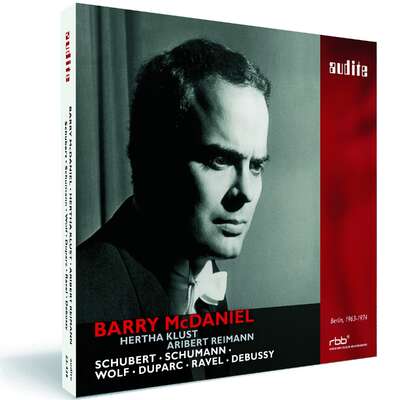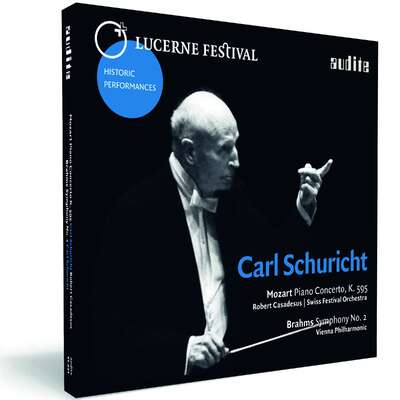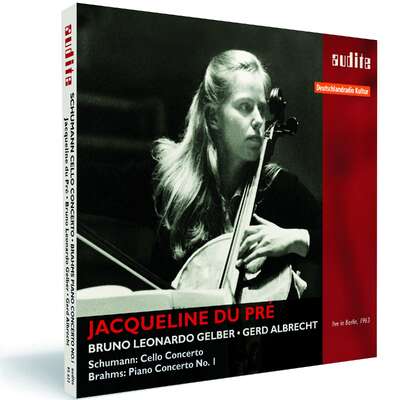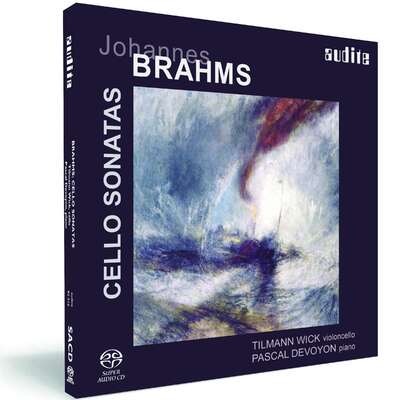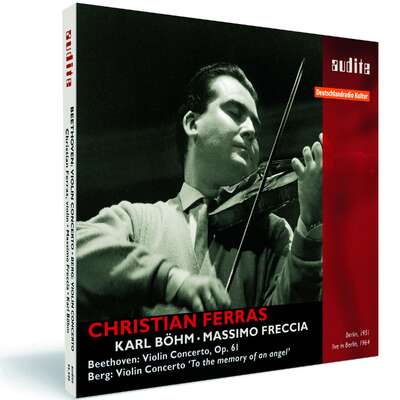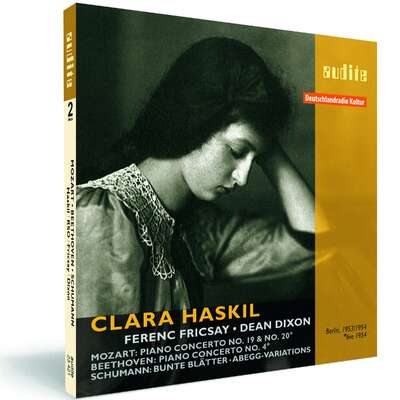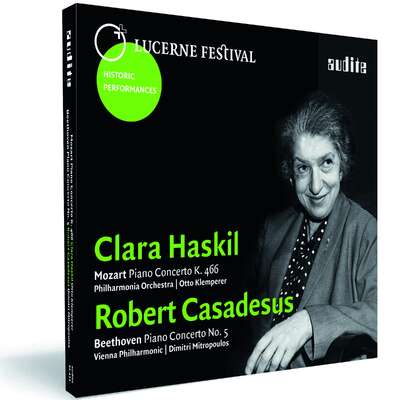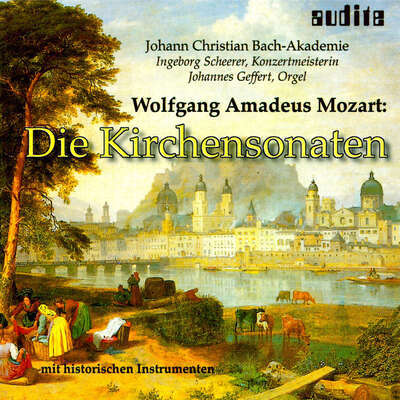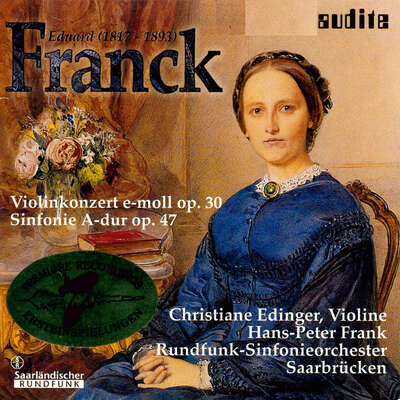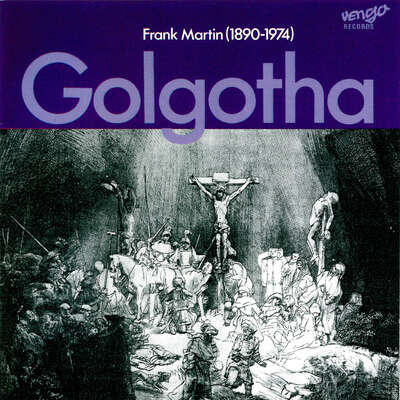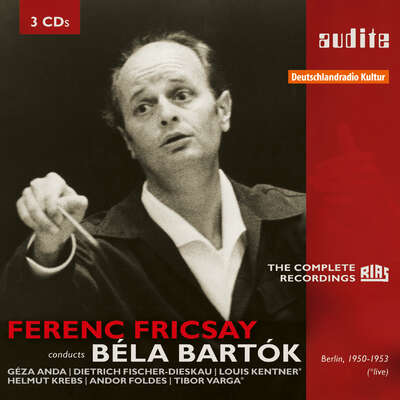Fono Forum | Mai 2012 | Götz Thieme | May 1, 2012
Pfundiges Erbe
Die bei Audite erschienene CD-Edition mit Wilhelm Furtwänglers RIAS-Vermächtnis wurde mehrfach ausgezeichnet. Nun veröffentlicht das Label einen Teil auf vierzehn LPs – eine Kollektion, die nicht nur eingefleischten Furtwängler-Fans Freude bereiten dürfte.
Es war die Schallplatte, die von ihm nicht sehr geliebte, die nach Wilhelm Furtwänglers Tod 1954 den Ruhm des Dirigenten am Leben hielt. Die ansMehr lesen
Es war die Schallplatte, die von ihm nicht sehr geliebte, die nach Wilhelm Furtwänglers Tod 1954 den Ruhm des Dirigenten am Leben hielt. Die ans Licht kommenden inoffiziellen Konzertmitschnitte mehrten die Legendenbildung, dokumentierten genauer Furtwänglers Größe. Die Studiobedingungen bei den kommerziellen Aufnahmen waren Furtwängler unbehaglich, es fehlte das Publikum, mit dem er den Austausch fand.
Noch zu Furtwänglers Lebzeiten kam auf LP der nicht autorisierte Mitschnitt eines Radiokonzerts mit Beethovens Dritter heraus, 1944 in Wien entstanden. Der erboste Dirigent klagte erfolgreich gegen das amerikanische Label Urania. Das war gewissermaßen der Beginn des Furtwängler-Platten-Kults; heute erzielt ein gut erhaltenes Exemplar dieser "Eroica" mehr als 1.500 US-Dollar – seltsam, dass Furtwängler sich gegen die Veröffentlichung aussprach, denn von seinen Aufnahmen ist sie wohl die überzeugendste. Nach seinem Tod änderte sich einiges. Die Witwe Elisabeth Furtwängler war großzügig bei der Freigabe von Live-Dokumenten. Begehrt waren bald die Konzertmitschnitte der Kriegszeit, vor allem die in Berlin entstandenen, nachdem Furtwängler 1947 wieder zu seinen Philharmonikern zurückgekehrt war. Die Übertragungen, meist vom RIAS, wurden in vielen Fällen von den Furtwängler-Gesellschaften auf Vinyl veröffentlicht.
Ein Coup gelang dem Label Audite 2009 mit der 12-CD-Edition "Live In Berlin" mit den kompletten Konzerten von Furtwängler und den Berliner Philharmonikern, die im RIAS-Archiv überdauert hatten, entstanden 1947 bis 1954 (siehe FONO FORUM 9/09). Der Tonmeister Ludger Böckenhoff konnte überwiegend auf die erhaltenen Originalbänder mit schnellerer Bandgeschwindigkeit (76 cm/s) zurückgreifen. Der Gewinn war bemerkenswert: Stabilität des Klangbildes, erweiterte Frequenzgänge und eine bessere Dynamik. Bald erreichten das Detmolder Audite-Team vor allem aus Japan und Korea Anfragen nach einer LP-Edition: Das Label war in bester Erinnerung mit seiner ausgezeichneten LP-Edition der Münchner Mahler-Aufnahmen von Rafael Kubelik.
Jetzt ist eine Auswahl der Furtwängler-Edition auf vierzehn LPs erschienen; 180-Gramm-Pressungen aus der Diepholzer Pallas-Manufaktur, beinahe vier Kilo bringt die Box auf die Waage. Der Handhabungsgrund und der Preis (um die 250 Euro) erklären, warum nicht alle Aufnahmen berücksichtigt wurden, was besonders bedauerlich bei den Violinkonzerten von Beethoven und Fortner mit Yehudi Menuhin respektive Gerhard Taschner ist, denn das analoge Medium schlägt gerade bei der Wiedergabe des Obertonspektrums deutlich die CD. Schade, dass Hindemith, Blacher und Strauss aussortiert wurden, der erschütternd schwarze Trauermarsch aus der "Götterdämmerung" und Furtwänglers sonnigste Version des "Meistersinger"-Vorspiels (beide von 1949): Sie sind Höhepunkte seiner Diskographie.
Doch die meisten Kunden wünschten sich vor allem die Sinfonien von Beethoven, Bruckner, Brahms und Schubert, heißt es bei Audite. Die Investition muss sich gelohnt haben, die Erstauflage, deren Zahl manche heutige Rattle-EMI-Produktion übersteigt (über genaue Zahlen schweigt man sich aus), ist ausverkauft, es wird nachgepresst. Eine Anmerkung für Puristen: Die Grundlage für die LP-Edition ist das digitale Master der CD. Anders hätte er beispielsweise Gleichlaufschwankungen nicht ausgleichen können, erklärt Ludger Böckenhoff.
Im Zentrum stehen Bruckners achte Sinfonie, Schuberts achte und neunte Sinfonie sowie je zwei Versionen von Beethovens dritter, fünfter, sechster Sinfonie und Brahms Dritter. Ein Vergleich der Medien bietet sich an, ist aber weniger erhellend, da die Grundcharakteristik durch die identische Masterquelle sich gleicht. Wie immer bei Vinyl verbinden sich die musikalischen Ereignisse zu einem flüssigeren Verlauf, andererseits erscheint die Zeitwahrnehmung verdichtet gegenüber der CD; ein Nebeneffekt der LP: Verzerrungen und Übersteuerungen wirken gemildert wie etwa zu Beginn des vierten Satzes der Dritten von Brahms, 1949 mitgeschnitten. Interessanter ist die Gegenüberstellung mit der LP-Ausgabe in der "Dacapo"-Reihe von Electrola, herausgekommen in den siebziger Jahren. Erstaunlich ist deren Klangbild: Die durchgängig analoge Kette und das 30 Jahre jüngere Bandmaterial machen sich bemerkbar. Die Berliner klingen körperhafter, das etwas dumpfere Timbre und der offenkundig zugefügte Hall stören nicht. Die EMI-Ausgabe ist atmosphärischer und mehr "live" – und das nicht nur wegen der Huster. Tritt Furtwängler hier als fesselnder Erzähler auf, ist er bei Audite mehr Berichterstatter. Ähnlich der Fall beim "Tristan"-Vorspiel: Auf der LP der deutschen Furtwängler-Gesellschaft sind die Instrumentalfarben gesättigter, der Hörer bekommt eine Vorstellung von der trockenen Akustik des Titania-Palastes. Bei Brahms Dritter von 1954 (gemessener gegenüber der nervösen fünf Jahre früher) punktet die Audite-Edition: Über der Deutsche-Grammophon-Ausgabe von 1976 liegt ein Schleier, das Klangbild ist muffig.
Alles in allem hat Audite ein Sammlerschmuckstück vorgelegt, das vieles erhellt, aber ebenfalls nicht erklärt, was die Größe dieses Dirigenten ausmacht. Wirkliche Größe sei ein "Mysterium", stellt Jakob Burckhardt in seinen "Weltgeschichtlichen Betrachtungen" fest. So ist es.
Es war die Schallplatte, die von ihm nicht sehr geliebte, die nach Wilhelm Furtwänglers Tod 1954 den Ruhm des Dirigenten am Leben hielt. Die ans